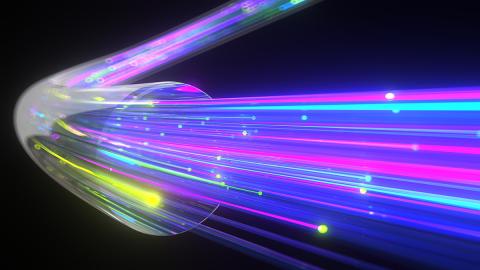Diagnostische Augentropfen beim Augenoptiker?
Ein Augenoptiker, der diagnostische Augentropfen verwendet, das ist in Deutschland noch Zukunftsmusik. Doch viele andere Länder haben den Optometristen in den Stand eines Gesundheitsberufs erhoben und ihm erweiterte Rechte zugesprochen.
Erstveröffentlicht in der DOZ 12I23
Eines der ersten Länder, in denen Optometristen diagnostische Augentropfen verabreichen durften, war England. Dort übernehmen seit Mitte der 1930er Jahre die Optometristinnen alle Untersuchungen und überweisen nur in operativen Fällen an die Augenärzte. Ende der 1960er Jahre zogen die skandinavischen Länder in Teilen nach, wodurch diagnostische Augentropfen auch außerhalb der Arztpraxis Anwendung finden. 2020 erweiterte die Schweiz die Rechte der Optometristinnen, wodurch diese diagnostische Augentropfen verabreichen dürfen. Die Revision des eidgenössischen Gesundheitsberufegesetzes ordnete den Optometristen als Gesundheitsberuf ein, wodurch dieser zusätzliche Kompetenzen, aber auch zusätzliche Verantwortungen zugesprochen bekam.
In Deutschland obliegt laut Rechtsprechung die Gabe diagnostischer Augentropfen allein den Augenärzten. Zu den diagnostischen Augentropfen gehören unter anderem Mydriatika und Zykloplegika. Während die Mydriatika auf die parasympathischen Fasern, die über den Musculus sphincter pupillae wirken, die Pupille weitstellen, bewirken die Zykloplegika eine vollständige Lähmung des Musculus cillaris, wodurch die Akkommodation ausgeschaltet wird. So werden Zykloplegika in der Hauptsache bei Kindern zur Refraktion eingesetzt. Die Mydriatika stellen die Pupille weit und ermöglichen so die periphere Netzhautuntersuchung.
Durch eine Erweiterung der Kompetenzen könnten Augenoptiker oder Optometristinnen diese Untersuchungen durchführen und so vorsondieren. Hierdurch würden, so das Hauptargument der Befürworter, die überfüllten Arztpraxen entlastet werden und dort in der Hauptsache nur noch die medizinisch relevanten Patienten sitzen. Ein nachvollziehbarer Gedanke – kennt doch jeder die Wartezeiten beim Arzt. Entstehen durch solch eine Änderung nur Vorteile oder gibt es auch Gründe, die dagegensprechen? Denn in vielen entwickelten Ländern auf der Welt dürfen Optometristen bereits diagnostische Augentropfen geben.
„Wir halten ein Gespräch für überflüssig“
Um zu erörtern, welche Vorteile oder auch Risiken aus solch einer Aufteilung entstehen könnten, hat die DOZ-Redaktion den Berufsverband der Augenärzte (BVA) in Deutschland angefragt. Dieser teilte in einer Stellungnahme mit: „Das Verschreiben von verschreibungspflichtigen Medikamenten ist in Deutschland Ärztinnen und Ärzten vorbehalten – die Gabe von verschreibungspflichtigen Augentropfen zur Diagnostik ist nur durch Ärzte und deren Assistenzpersonal in Klinik und Praxis zulässig. Somit halten wir ein Gespräch für überflüssig“.
„Eine einheitliche biomedizinische und klinische Ausbildung ist Grundvoraussetzung für eine mögliche gesetzliche Regelung für den Einsatz diagnostischer Pharmaka durch deutsche Optometristen“, findet Wolfgang Cagnolati.
Auch die Meinungen der Augenoptikerinnen sind sehr unterschiedlich. Während die eine sagt: „Warum sollten wir das nicht dürfen?“, findet der nächste, dass es zu viele Risiken gebe. Es ist weithin bekannt, dass gewisse Risiken mit der Gabe von Mydriatika oder Zykloplegika einhergehen können. „Diese Argumente werden oft im Kontext mit der Möglichkeit eines akuten Winkelblocks in Verbindung mit der Applanationstonometrie oder generell dem Einsatz von Mydriatika genannt“, erklärt Wolfgang Cagnolati. „Die Inzidenz für einen medikamentös induzierten akuten Winkelblock ist aber relativ gering und liegt laut einer umfangreichen niederländischen Studie bei ungefähr 0,03 Prozent der Bevölkerung oberhalb von 55 Jahren“, führt der Duisburger Optometrist als Befürworter der Einführung solcher Rechte für Optometristen in Deutschland weiter aus.
Ein in Deutschland praktizierender Augenarzt, der aufgrund der verbandspolitischen Brisanz des Themas lieber anonym bleiben möchte, erklärt: „Vor allem bei hyperopen Patienten kann durch den meist engeren Kammerwinkel ein Engwinkelglaukom auftreten. Jedoch kam das in dieser Praxis seit Jahren nicht mehr vor und ist insgesamt sehr selten. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Trauma am Auge. Wenn dadurch der Musculus sphincter pupillae verletzt wird, könnte es sein, dass die Pupille nach dem Tropfen nicht mehr klein wird.“ In letzterem Fall würde man mit entsprechenden Augentropfen die Wirkung rückgängig machen. Wichtig sei das Wissen, wann getropft werden darf und wann nicht. Alles Dinge, die grundsätzlich erlernbar sind. Der Augenarzt und Cagnolati sind sich einig: Die medizinischen Gründe sind nicht die ausschlaggebenden Risikopunkte.
Geringer Nutzen durch bildgebende Verfahren?
Der Einsatz diagnostischer Medikamente durch Optometristen in Deutschland setze im Bereich der höheren Fachausbildung eine einheitliche biomedizinische und klinische Ausbildung voraus, findet Cagnolati. „Eine solche Ausbildung ist die Grundvoraussetzung für eine mögliche gesetzliche Regelung für den Einsatz diagnostischer Pharmaka durch deutsche Optometristen. An der Berliner Hochschule für Technik werden die Studierenden zum Beispiel im Studiengang Augenoptik/Optometrie bereits im Umgang mit diagnostischen Augentropfen unterrichtet. In vielen europäischen Ländern wird dieses Wissen vorausgesetzt, um dort als Optometrist arbeiten zu dürfen.“ Der Augenarzt wiederum meint: „Ich kenne Augenoptikerinnen und Augenoptiker, die so versiert sind, dass ich keine Bedenken hätte, sollten diese tropfen. Aber das ist leider nicht bei jedem gegeben. Deshalb muss es eine allgemeingültige Abgrenzung geben und solange die Standards nicht einheitlich sind, sollte der Status Quo bleiben.“
Nur Augenärzte können Medikamente in Apotheken beziehen
Unabhängig von der Zusprechung erweiterter Rechte würde eine weitere Angelegenheit geregelt werden müssen: „Damit Augenoptiker Arzneimittel mit den allesamt verschreibungspflichtigen Hauptwirkstoffen Atropin, Cyclopentolat oder Tropicamid im Rahmen ihrer Untersuchungen einsetzen dürfen, müsste der gesamte regulatorische Rahmen der Gesundheitsberufe im Allgemeinen von Grund auf geändert werden. Denn der Einsatz dieser Medikamente dürfte wohl unter eine erlaubnispflichtige Ausübung der Heilkunde fallen, die den Ärzten vorbehalten ist“, gibt der ZVA zu bedenken. Und weiter: „Aber selbst wenn Augenoptiker diese einsetzen dürften, bleibt noch das ganz praktische Problem, sie zu erwerben: So dürfen Arzneimittel nur in Apotheken in den Verkehr gebracht werden – sind sie verschreibungspflichtig, bedarf es einer ärztlichen Verordnung.“
So scheint es nicht nur eine Frage des Dürfens oder Nicht-Dürfens zu sein. „Bevor das Thema diagnostische Medikamente für Optometristen in Deutschland auf eine politische Agenda kommt, muss im Berufsstand intern geklärt werden: Wie sieht die Zukunft der deutschen Optometrie aus – für wen soll das Recht gelten, solche Pharmaka einzusetzen?“, meint Cagnolati. Doch was müsste geändert werden, sollten diagnostische Augentropfen in Deutschland auch von Augenoptikerinnen verabreicht werden dürfen? In den europäischen Ländern, in denen bereits mit diagnostischen Augentropfen gearbeitet wird, gehört „Optometrist“ zu den Gesundheitsberufen. In Deutschland ist dies nicht der Fall. Somit müsste geregelt werden, was diese Änderungen umfasst und was es für den Meistertitel und den Optometristen bedeutet. Aktuell haben beide die gleichen Berufsrechte – ob sich dies dann wie in der Schweiz wandelt und der Meister eine Zusatzqualifikation für die diagnostischen Augentropfen benötigt oder es einer anderen Regelung bedarf, wäre zu klären. Nach wie vor ist offen, ob Optometristen und Augenoptikerinnen in Deutschland jemals diagnostische Augentropfen werden verabreichen dürfen. Doch wenn, werden jene, die es tun wollen, eine entsprechende Fortbildung benötigen. Sei es ergänzend oder im gewünschten Studium.
Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich? Wenn Augenoptikerin (links) und Augenarzt zusammen tanzen, „können alle Beteiligten davon nur profitieren“.
"Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich"
Aktuell wie in Zukunft dürfte trotz allem eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Augenärztinnen und Augenoptikern am wichtigsten sein, um den Patienten so gut wie möglich weiterzuhelfen. Dem anonymen Augenarzt zufolge sei das Denken „Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich“ noch zu ausgeprägt, doch er ist sicher: „Wenn man die Schrankensetzung beiseitelässt, können tolle Kooperationen entstehen und davon können alle Beteiligten nur profitieren.“